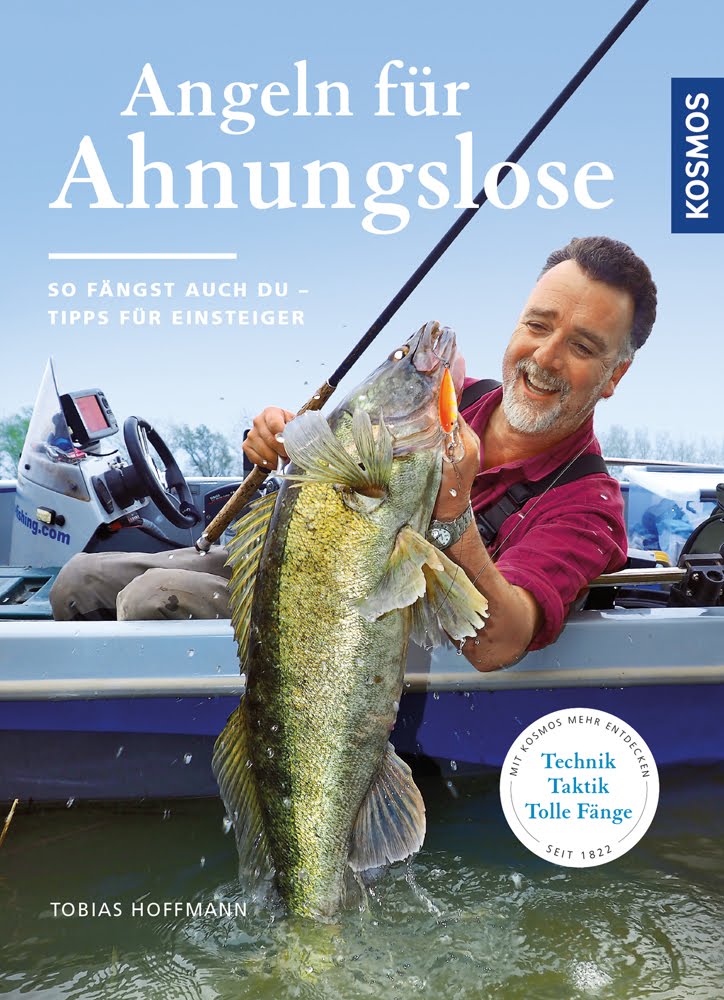Die Fahrt vom sonnenverwöhnten Süden in den Norden gleicht einer Reise durch mehrere Klimazonen. Je weiter die Straße sich in die Höhe windet, desto mehr verändert sich die Vegetation. Kakteen und karge Felsen weichen allmählich saftigem Grün, Palmen und blühenden Gärten. Meine Unterkunft liegt mitten in dieser fruchtbaren Region, wo die Passatwolken vom Atlantik gegen die Berghänge drücken und für eine fast märchenhafte Frische sorgen.
San Juan de la Rambla ist einer dieser Orte, die man nicht in Reiseführern sucht, sondern eher zufällig findet und dann nie wieder vergisst. Das kleine Küstendorf schmiegt sich an steile Klippen, und die Häuser scheinen sich gegenseitig festzuhalten, um nicht ins Meer zu rutschen. In den engen Gassen riecht es nach Salzwasser und frisch gebackenem Brot aus der kleinen Bäckerei an der Plaza. Die natürlichen Meerwasserpools zwischen den schwarzen Lavafelsen sind ein Geheimtipp: Hier kann man schwimmen, während die Wellen des Atlantiks meterhoch gegen die Klippen donnern, nur wenige Meter entfernt und doch durch die schützenden Felsformationen abgeschirmt. Doch auch hier ist Vorsicht geboten. Ende 2025 wurden in Puerto de la Cruz einige Urlauber ins Meer gerissen, nachdem die gefürchteten Riesenwellen gegen die Brandung schlugen.
Puerto de la Cruz ist das genaue Gegenteil der verschlafenen Ruhe von San Juan, und doch hat auch diese Stadt ihren ganz eigenen Charme bewahrt. Die Altstadt mit ihren kolonialen Gebäuden, den schattigen Plätzen und den traditionellen kanarischen Balkonen aus dunklem Holz erzählt von einer Zeit, als dies der wichtigste Hafen der Insel war. Im Lago Martiánez, dem spektakulären Schwimmbadkomplex des Künstlers César Manrique, verschmelzen Architektur und Natur zu einem Gesamtkunstwerk. Die geschwungenen Becken mit ihrem türkisfarbenen Wasser, umgeben von Palmen und Vulkangestein, sind wie eine Hommage an die Elemente.
Der zweite Tag führt mich weiter die Nordküste entlang nach Garachico, eine Stadt mit einer dramatischen Geschichte. Im Jahr 1706 begrub ein Vulkanausbruch den damaligen Haupthafen unter Lava und veränderte das Schicksal der Stadt für immer. Heute sind genau diese Lavaformationen, die El Caletón bilden, das Herzstück des Ortes. In den natürlichen Pools zwischen den erstarrten Lavazungen zu baden, während die Sonne langsam höher steigt und das Wasser in immer neuen Türkistönen schimmern lässt, ist ein Erlebnis von zeitloser Schönheit. Die kleine Festung Castillo de San Miguel wacht über dieses Naturschauspiel wie ein stummer Zeuge der bewegten Vergangenheit.
Von Garachico aus windet sich die Straße ins Teno Gebirge, ein zerklüftetes Massiv, das so wirkt, als wäre es erst gestern aus dem Meer gestiegen. Die Serpentinen werden enger, die Abhänge steiler, die Ausblicke atemberaubender. Die Schlucht rund um Masca ist an Dramatik kaum zu überbieten. Die Fahrt durch die engen Straßen ist nicht ganz ungefährlich, wenn große Felsen bei Regen von den Steilhängen abbrechen und die Fahrbahn versperren.
Masca thront wie ein Adlernest zwischen schroffen Felsformationen, ein Dorf, das trotz seines Tourismus nichts von seiner rauen Ursprünglichkeit verloren hat. Die ockerfarbenen Häuser schmiegen sich an die Felswände, verbunden durch steile Treppen und schmale Pfade. Von hier aus führt eine spektakuläre Wanderung durch die Masca Schlucht hinunter zum Meer, ein Abstieg durch Jahrmillionen Erdgeschichte, vorbei an überhängenden Felswänden und durch fast tropische Vegetation.
Das Anaga Gebirge am dritten Tag ist wie der Eintritt in eine andere Epoche. Dieses uralte Vulkanmassiv im Nordosten der Insel ist von einem der letzten verbliebenen Lorbeerwälder Europas bedeckt, einem lebenden Fossil aus einer Zeit, als solche Wälder den gesamten Mittelmeerraum bedeckten. Die Fahrt durch das Gebirge führt durch dichten Nebel, der zwischen den Bäumen hängt und die Landschaft in ein mystisches Licht taucht. Moose und Flechten überziehen jeden Stamm, jeden Stein, und das permanente Tröpfeln des Nebels schafft eine Atmosphäre, die gleichzeitig unwirklich und zutiefst lebendig ist.
Taganana liegt am Ende einer kurvigen Abfahrt, ein Dorf, das sich an die Berghänge klammert und zum Meer hin öffnet. Die steilen Terrassenfelder, auf denen jahrhundertelang Wein angebaut wurde, prägen noch immer die Landschaft. In einem der kleinen Restaurants am Dorfplatz schmeckt der frisch gefangene Fisch nach Meer und Abenteuer, begleitet von einem Glas lokalen Weißwein, der die Mineralität des Vulkanbodens in sich trägt.
Benijo, nur wenige Kilometer entfernt, ist der Ort für alle, die Strände abseits der Postkartenidylle suchen. Der schwarze Vulkansand, die wilden Wellen, die sich an den bizarren Felsnadeln brechen, die vor der Küste aus dem Wasser ragen, all das schafft eine Kulisse von wilder, ungezähmter Schönheit. Hier versteht man, warum die Ureinwohner der Insel, die Guanchen, glaubten, dass in diesen Bergen Götter wohnen.
 Raue Küste und starker Wellengang vor Benijo mit den charakteristischen Felsformationen (Bildquelle: Tobias Hoffmann)
Raue Küste und starker Wellengang vor Benijo mit den charakteristischen Felsformationen (Bildquelle: Tobias Hoffmann)Der vierte Tag beginnt früh, denn der Weg zum Teide Nationalpark führt ins Herz der Insel. Mit 3.715 Metern ist der Pico del Teide nicht nur Spaniens höchster Berg, sondern auch ein schlafender Riese, dessen letzte Eruption erst gut hundert Jahre zurückliegt. Die Fahrt durch die verschiedenen Vegetationszonen ist wie eine beschleunigte Zeitreise: von den grünen Kiefernwäldern der mittleren Höhen bis in die mondähnliche Landschaft der Cañadas, wo bizarre Felsformationen aus rotem, gelbem und grauem Gestein eine surreale Kulisse bilden.
Oben, in über 2.000 Metern Höhe, ist die Luft dünn und klar. Die Aussicht reicht an klaren Tagen bis zu den Nachbarinseln La Gomera, El Hierro und La Palma. Die Roques de García, diese gewaltigen Steinformationen, die wie versteinerte Wächter in der Landschaft stehen, erinnern daran, dass hier unter unseren Füßen unvorstellbare Kräfte schlummern. Der Spaziergang durch diese Landschaft ist wie ein Gang auf einem anderen Planeten, begleitet nur vom Wind und dem Knirschen vulkanischen Gerölls unter den Sohlen.
 Der Teide Vulkan mit typischer Mondlandschaft, Schnee und Felsformationen wie den Roques de García (Bildquelle: Tobias Hoffmann)
Der Teide Vulkan mit typischer Mondlandschaft, Schnee und Felsformationen wie den Roques de García (Bildquelle: Tobias Hoffmann)Am Nachmittag führt die Route westwärts nach Los Gigantes, wo die Insel ihr vielleicht dramatischstes Gesicht zeigt. Die Steilklippen, die hier fast senkrecht aus dem Meer aufragen, tragen ihren Namen zu Recht: bis zu 600 Meter hohe Felswände aus dunklem Basalt, an denen sich die Wellen brechen und die bei Sonnenuntergang in einem Spiel aus Licht und Schatten versinken. Von der kleinen Marina aus kann man mit etwas Glück Delfine oder sogar Pilotwale beobachten, die in den Gewässern vor den Klippen heimisch sind.
Santa Cruz de Tenerife empfängt mich am fünften Tag mit großstädtischem Flair und kanarischer Gelassenheit. Die Hauptstadt ist keine klassische Touristenstadt, sondern ein lebendiger Ort, an dem die Menschen der Insel wirklich leben, arbeiten und feiern. Der modernistische Bau des Auditorios, entworfen von Santiago Calatrava, erhebt sich wie eine weiße Skulptur am Hafen, ein architektonisches Statement, das die Brücke zwischen Tradition und Moderne schlägt.
In den Straßen der Altstadt mischt sich das Aroma frisch gerösteten Kaffees mit dem Duft exotischer Blumen vom Mercado de Nuestra Señora de África. Dieser Markt ist ein Fest für alle Sinne: Berge von tropischen Früchten, deren Namen ich nicht einmal alle kenne, frischer Fisch auf Eis, kunstvoll arrangiert wie in einem Museum, Gewürze, Käse und das herzliche Geschrei der Händler, die ihre Ware anpreisen. Hier zeigt sich Teneriffa in seiner authentischsten Form.
Nur eine kurze Fahrt von der Hauptstadt entfernt wartet die Playa de las Teresitas, ein Strand wie aus dem Bilderbuch, allerdings mit einem interessanten Detail: Der goldgelbe Sand wurde einst aus der Sahara importiert. Das kleine Fischerdorf San Andrés am südlichen Ende des Strandes hat sich seine Ursprünglichkeit bewahrt. In den Restaurants an der Strandpromenade wird der Fisch noch am selben Tag gefangen, auf dem er auf den Tisch kommt, und die Art, wie die Einheimischen hier ihre Mittagspause verbringen, langsam, genussvoll und immer mit Blick aufs Meer, ist eine Lektion in Lebenskunst.
Der letzte Tag schließt den Kreis. El Médano im Süden ist das Reich der Surfer und Windsurfer, ein Ort, an dem der Wind fast immer weht und die entspannte Atmosphäre eines ewigen Sommers herrscht. Der Strand zieht sich über Kilometer hin, gesäumt von niedrigen Häusern und kleinen Bars, in denen man barfuß und in Badehose willkommen ist. Der charakteristische rote Felsen Montaña Roja wacht über die Bucht, und bei Sonnenuntergang verwandelt sich die gesamte Szenerie in ein Gemälde aus Gold und Purpur.
Ein Abstecher nach Playa de las Américas zeigt die andere Seite des Südens. Hier pulsiert das touristische Herz der Insel mit Hotels, Restaurants und Einkaufszentren. Doch selbst hier, zwischen den modernen Anlagen, finden sich ruhige Ecken: kleine Buchten mit schwarzem Sand, Promenaden, auf denen sich Einheimische und Besucher zum Spaziergang in der Abendbrise treffen, und Terrassen mit Blick auf den endlosen Atlantik.
Abendstimmung an der Promenade von El Médano (Bildquelle: Tobias Hoffmann)
Während die letzten Surfer ihre Bretter aus dem Wasser tragen und die Sonne sich langsam dem Horizont nähert, erwacht auf der Mole von El Médano ein anderes Ritual zum Leben. Die Einheimischen kommen in kleinen Gruppen, beladen mit Angelruten, Eimern und Kühlboxen, in denen frische Garnelen und Tintenfischstücke auf ihren Einsatz warten. Es sind meist dieselben Gesichter, die sich hier Abend für Abend einfinden, Männer und auch einige Frauen, die sich mit einem Nicken begrüßen und ihre Stammplätze auf den sonnenwarmen Steinen einnehmen.
Die Atmosphäre ist gesellig und gleichzeitig konzentriert. Während die Köder vorbereitet werden, wird geplaudert, gelacht, manchmal auch diskutiert. Jeder hat seine eigene Technik, seine Geheimtipps, die aber bereitwillig geteilt werden, wenn man freundlich fragt. Die Ruten werden ausgeworfen, die Schnüre straffen sich im Wind, und dann beginnt das geduldige Warten. Manchmal zappelt eine Brasse am Haken, silbern glänzend im letzten Licht des Tages, manchmal ein Meerbarsch oder einer der begehrten Papageienfische, deren bunte Schuppen selbst im Dämmerlicht noch leuchten. Ein alter Fischer, dessen Hände die Geschichte unzähliger Fänge erzählen, zeigt mir grinsend seinen Eimer, in dem bereits drei stattliche Fische liegen. Der Stolz in seinen Augen braucht keine Worte. Hier auf der Mole, zwischen Salzluft und dem rhythmischen Plätschern der Wellen gegen den Beton, spielt sich jeden Abend ein kleines Stück authentisches Inselleben ab, weit entfernt von den Strandliegen und Cocktailbars nur wenige hundert Meter weiter.
Nachdem ich den Kleinwagen am Flughafen zurückgebe und nach dem Abflug ein letztes Mal auf die Silhouette des Teide blicke, der sich gegen den Himmel abzeichnet, wird mir bewusst, wie viele Gesichter diese vermeintlich kleine Insel hat. Teneriffa ist nicht eine Insel, sondern viele: grün und üppig im Norden, karg und sonnig im Süden, wild und ursprünglich in den Bergen, lebendig und urban in den Städten. In sechs Tagen habe ich die Insel umrundet, aber im Grunde habe ich gerade erst begonnen, sie zu verstehen. Und vielleicht ist genau das der Grund, warum man immer wieder zurückkehren möchte.